Die Internationale Dental-Schau (IDS) 2025 hat in Köln eine Vielzahl von Innovationen ins Schaufenster gestellt. Sie reichen von digitalen Technologien und ihrer Erweiterung in Richtung Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz (KI) bis hin zu Hilfsmitteln für klassische zahnmedizinische und zahntechnische Verfahren. Als besonders stark erweist sich die Kombination bewährter und innovativer Produkte.
Bei den bildgebenden Verfahren etwa (z.B. Röntgen, Fluoreszenzaufnahmen, Intraoralscans) wird die Beurteilung der Mundgesundheit leichter. Insbesondere fluoreszenzfähige Intraoralscanner lassen sich als Karies-scoring-System einsetzen. Erkrankungen sind frühzeitig erkennbar und so lässt sich noch vor dem Auftreten von Symptomen rechtzeitig eine gezielte Prophylaxe einleiten.
Kombi-Diagnostik – KI-unterstützte Auswertung
Als wertvoll erweist sich dabei die Assistenz durch Software. Damit lassen sich Karies zielgenauer detektierten, eine cephalometrische Analyse durch automatisches Festlegen von Orientierungspunkten im Röntgenbild beschleunigen oder Entscheidungen bei Extraktionen und bei orthognather Chirurgie vorbereiten. Bei der Kariesdiagnose kann sich der Zahnarzt von Künstlicher Intelligenz mit einer vollautomatisierten Röntgenbefundung unterstützen lassen.
So kann KI frühe Karies auf Bissflügelröntgenbildern bereits besser erkennen als der Mensch. Auf der Basis eines Panoramaröntgenbilds nimmt aktuelle Software eine Vorklassifikation vor, stellt sie in einem klassischen Zahnschema und in einer Detektions-Liste dar: „Brücke von 47 auf 45, Karies an 44, 43 intakt usw.“ – das braucht der Zahnarzt „nur“ noch zu kontrollieren und bei Bedarf zu korrigieren.
Eine gleichzeitig generierte farbige Darstellung des Befundes lässt sich mit dem Patienten viel besser besprechen als ein Schwarz-weiß-Röntgenbild. Hinzu kommt: All diese Auswertungen sind elektronisch verfügbar und damit unter Kollegen austauschbar.
Kombinierte Bildinformationen fürs Backward-planning
Besonders in der Implantologie schafft das „Zusammen-Matchen“ von Intraoralscans, 3D-Röntgenaufnahmen und Computertomogrammen die Grundlage für das heutige Backward-planning. Hinzu tritt jetzt die Magnetresonanztomographie (MRT), ein bildgebendes Verfahren ohne ionisierende Strahlung. Insbesondere Sekundärkaries und okkulte Karies lassen sich damit besser diagnostizieren als mit herkömmlichen Methoden. So könnten vor allem die Dimensionen kariöser Läsionen in Zukunft genauer bestimmt werden.
Ebenso könnte das MRT in der Parodontaldiagnostik eine größere Rolle spielen. Denn sie zeigt schon früher als Bleeding-on-probing und Röntgenbilder, dass ein Knochenabbau vorliegt.
Kombinierte Prophylaxe-Verfahren – viele Wege zum Ziel
In der professionellen Prophylaxe geht der Trend hin zu multifunktionalen Systemen: Ultraschallhandstück plus Pulver-Wasserstrahl-Handstück in einem und alles zusammen mit höchstem Behandlungskomfort. Zum Beispiel so: Das Ultraschallhandstück schwingt elliptisch und kann, wie auch das Pulverstrahlhandstück, in zwölf verschiedenen Abstufungen (Wassermenge, Auftragsstärke) feinreguliert werden. Auch die Wassertemperatur ist in vier verschiedenen Stufen für ein schmerzfreies Verfahren einstellbar.
Darüber hinaus stehen Handinstrumente, Ultraschallsysteme und Air-Polishing-Geräte für die professionelle mechanische Plaque-Entfernung inklusive subgingivalem Debridement zur Auswahl. Und Winkelstücke mit besonders schlankem Hals und kleinem Kopf sowie darauf abgestimmte Polierschalen ermöglichen einen leichten Zugang auch zu „schwierigen“ Regionen der Mundhöhle.
Es führen viele Wege zum gewünschten Ziel: Einer etwa verläuft über ein Set moderner Handinstrumente, von denen eines über Spitzen aus Vollmaterial verfügt, was besonders gute Präzision verspricht. Dies ermöglicht sowohl die Dekontamination von Parodontaltaschen als auch die Wurzeloberflächenglättung.
Die parodontologischen Teams profitieren bereits bei der Befundung von moderner digitaler Technik. So erfolgt die Bestimmung der Taschentiefen traditionell mit einer Sonde, digital unterstützte Spezialausführungen ermöglichen eine automatische Dokumentation, mit solchen „Computer-PA-Sonden“ können Befunde auch ohne Chairside-Assistenz erfasst werden.
Füllungstherapie: Spezial- neben Universalwerkstoffen
Zahnfarbene Füllungsmaterialien gewinnen im Licht der Patientenwünsche nach höherer Ästhetik immer mehr an Bedeutung. Und sie werden immer vielfältiger: klassische Komposite für die inkrementelle Technik; Bulkfill-Komposite für eine schnelle Füllung „in einem Zug“; glasfaserverstärkte Komposite für großvolumige Versorgungen; Glasionomerzemente für Füllungen ohne Adhäsivtechnik; fluoridfreisetzende Kompomere sowie Ormocere und selbstadhäsive Komposithybrid-Harze. Hinzu kommen neuere Spezialitäten wie Nano-Hybrid-Ormocere, bei denen Siliziumdioxid die chemische Basis sowohl für die Füllstoffe (nano- und glaskeramische Füllstoffe) als auch – und das ist neu – für die Harzmatrix bildet.
Neue universelle Komposite erleichtern die tägliche Arbeit. Sie sind sowohl im Front- als auch im Seitenzahnbereich einsetzbar, können in eine bis zu 4 Millimeter starke Kavität eingebracht und dann ausgehärtet werden und gewährleisten dank einer speziellen Füllertechnologie eine komfortable Handhabung. Eine vereinfachte Farbauswahl mit nur vier Farben macht es einfach, ästhetische Ergebnisse zu erzielen.
Teilmatrizensysteme werden häufig verwendet, um das Restaurationsmaterial in Position zu halten. Sie können selbst die anspruchsvollsten Anforderungen der Klasse II erfüllen und werden immer sicherer und komfortabler in der Anwendung. Nickel-Titan-Ringe bieten Festigkeit und Elastizität zugleich. Eine PEEK-Rückenverstärkung erhöht den Zahnseparationsdruck sowie die Langlebigkeit des gesamten Systems. Retentionsspitzen verbessern die Retention und ein fortschrittliches Weichsilikon sorgt dafür, dass sich der Ring an den Zahn anpasst.
Für die adhäsive Befestigung werden verschiedene Produkte verwendet, die den Einsatz von minimalinvasiven und ästhetischen Restaurationsmaßnahmen erst möglich gemacht haben. Dazu gehören so genannte Universaladhäsive. Sie sind breit indiziert und funktionieren zum Teil auch bei zu feuchtem oder zu trockenem Dentin. Es gibt auch das Konzept der selbstadhäsiven Komposite. Sie haften ohne ein separates Adhäsiv.
Im verwandten Gebiet der Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) kommen ähnliche Verfahren zum Wiederaufbau zerstörter Zähne zum Zuge, doch die Ätiologie der Erkrankung ist eine ganz andere. Mittlerweile gibt es dafür jetzt ein validiertes, minimalinvasives Behandlungskonzept inklusive Infiltration und Zahnaufhellung.
Für Patienten mit dem Wunsch nach einem effektiven Verfahren für das Home-Bleaching steht jetzt ein Wasserstoffperoxid-Gel mit besonders stabiler Konsistenz zur Verfügung. So kann es bei Raumtemperatur gelagert werden. Wenn es dann zum Einsatz kommt benötigt der Patient für die Zahnaufhellung nur 15 bis 30 Minuten. Selbstverständlich erfolgt diese Art des Bleachings unter professioneller zahnärztlicher Begleitung – für gut Erfolgsaussichten und ein hohes Maß an Sicherheit.
Kontinuierliche und reziproke Feilenbewegung kombiniert
Mit immer mehr „Safety“-Funktionen kommen Endo-Motoren in die Praxis. Es ist ähnlich wie beim Antiblockiersystem, beim Bremsassistenten und beim Elektronischen Stabilitätsprogramm für das Automobil: Das Endo-Team kann sich durch verschiedene Assistenz-Systeme unterstützen lassen. Zu ihnen gehört die automatische Drehmomentkontrolle; sie ist mit einem automatischen Stopp bei Überschreiten eines kritischen Drehmoments verbunden. Auch bei Erreichen des Apex erfolgt ein Autostopp. In einem speziellen Modus werden kontinuierliche und reziproke Aufbereitung miteinander kombiniert und je nach Situation gewechselt. Damit wird die Feile immer wieder entlastet und das Bruchrisiko sinkt.
Für schnelle Reaktionszeiten auf unerwünscht hohe Drehzahl- und Drehmoment-Schwankungen oder -ausbrüche sorgen sensorlose Motorsteuerungen (eine Weiterentwicklung gegenüber den herkömmlichen bürsten- und sensorbasierten Motorsteuerungen). Die damit mögliche „Sofortreaktion“ erlaubt eine stabile Einstellung der Feilen. Und die Dynamik einer fortlaufenden endometrischen Längenbestimmung während der aktiven Aufbereitung in Kombination mit einer – falls notwendig – automatischen Drehrichtungsumkehr hilft dem Zahnarzt dabei, die Feile stets auf dem gewünschten Ziel zu halten.
Ziel bei der Arbeitsvorbereitung: volle Kostenkontrolle
Die innovativen Trends zur IDS mit dem Schwerpunkt Zahntechnik beginnen bereits bei der Arbeitsvorbereitung und damit bei einem aufwendigen und mit hoher Konzentration verbundenen Schritt, der sich dennoch schwer in ökonomische Erfolge ummünzen lässt. Hier trägt fortgeschrittene Software dazu bei, im Labor die Kosten im Griff zu behalten. Selbst Einsteiger können die aktuellen Programme unmittelbar professionell einsetzen, so eingängig sind die Erläuterungen auf dem Monitor. Auf diese Weise lassen sich selbst großspannige Arbeiten mit unterschiedlichen Komponenten und Kontaktpunkten (z.B. zur Sanierung eines ganzen Kiefers) in wenigen Schritten ohne spezielle Software-Vorkenntnisse umsetzen.
Die benötigten Informationen kommen zum Beispiel in Form eines Intraoralscans im Labor an. Daneben bleibt die analoge Modellerstellung unverzichtbar und ist erste Wahl bei komplexen Fällen wie etwa bei implantatgetragenen großspannigen Stegen und Teleskoparbeiten. Im weiteren Verlauf spielen bei der CAD-Konstruktion für implantatprothetische Restaurationen die Scanbodys eine zentrale Rolle. Hier lautet die Gretchenfrage: „Welche davon sind in unserer Software schon hinterlegt?“ Danach entscheidet sich, in welche Erweiterungen oder in welche neue Software gegebenenfalls zu investieren ist, um das Angebotsspektrum des Labors zu arrondieren oder neu zu formieren.
Generell eignet sich für die CAD-Konstruktion Software mit der Möglichkeit zur virtuellen Einartikulierung. Sie wird, in manchen Fällen auch dank der Fortschritte im Cloud-Computing, für immer mehr Labors zur Alltagsnormalität. Denn auf diese Weise besteht eine immer größere Auswahl zwischen unterschiedlichen Programmen.
Softwaregestützte ästhetische Gestaltung auf neuem Niveau
Spezielle Softwares für das Micro-Layering kombinieren die monolithische Fertigung mit der keramischen Verblendung. Nicht zuletzt dank einer Fotoimportfunktion und einem „Colormapping“ erscheint eine vollanatomische 3D-Darstellung mit realistischer Zahnfarbgebung auf dem Monitor.
Ist das Design am Bildschirm abgeschlossen, stellt sich die Frage nach der Art der Fertigung der betreffenden Restauration. Hier steigt die Zahl der Optionen: gießen oder fräsen bzw. schleifen oder additiv fertigen. Und die Zahl der aktuellen Verbesserungen im Detail ist groß.
Fähigkeit zum Dauerfräseinsatz in der Zahntechnik
Beispielsweise tragen vierachsige CAD/CAM-Fräsmaschinen dem Wunsch nach einer Top-Dauerbetriebs-Performance mit einer Wasserkühlung der Spindel Rechnung – gezielt auf den Wirkbereich zwischen Werkzeug und Werkstück gerichtet. Das ermöglicht es, häufiger auf zusätzliche Schleifmittel verzichten zu können; nur bei der Verarbeitung von Titan (i.d.R. für Abutments) bleiben sie unbedingt notwendig. Avancierte Fünfachs-Trockenfräser punkten mit einer effizienteren Bearbeitung gerade der härtesten Werkstoffe (namentlich Kobalt-Chrom).
Gerade im Bereich der additiven Fertigung sieht sich jeder Anwender mehr und mehr Optionen gegenüber. Dazu zählen im Bereich des Metalldrucks die Laser-Metal-Fusion-Technik (LMF), das Selektive Laserschmelzen, SLM-Verfahren („selective laser melting“), Selektives Lasersintern (SLS), Direktes Metall-Lasersintern (DMLS) und das Lasercusing. Mit allen genannten Verfahren werden Kronen, Brücken und Prothesenbasen („digitale Modellgussbasen“) aus edelmetallfreien Dentallegierungen gefertigt.
Praktisch alle denkbaren Geometrien lassen sich realisieren. Damit sind verschiedene Schritte nicht mehr notwendig: beispielsweise ein Separieren zwischen Brückengliedern oder eine Fräserradiuskorrektur. Stattdessen genießt der Zahntechniker viel Platz und kann Retentionen für Kunststoffverblendungen und Hinterschnitte ohne weiteres in jedes Objekt integrieren.
Kombination: Fertigungsoptionen und neue Geschäftsmodelle
Die Herstellung in großen Stückzahlen macht die additive Fertigung von zahntechnischen Objekten so richtig effektiv. Auf eine Standard-Bauplattform mit 100 Millimetern Durchmesser passen bis zu 100 Kronen, die dann in fünf Stunden gedruckt werden können – mit einem Doppellaser sogar schon in drei Stunden. Über Kronen hinaus zählen zu den druckbaren Objekten auch Brücken, Stege und Suprakonstruktionen sowie alle implantatgestützten Objekte wie Einzelabutments, Teleskopkronen, Primär- und Sekundärteile, KFO-Apparaturen, Modellgussklammerprothesen und Teilprothesen.
Durch den additiven Aufbau von Metallstrukturen verschieben sich auch Geschäftsmodelle. Im Einzelfall gilt es oft zu entscheiden, wo gefertigt werden soll: im eigenen Labor, im Kooperationslabor, beim Zentralfertiger oder beim industriellen Service.
In der additiven Fertigung aus Kunststoff lassen sich mit Hilfe des DPS-Verfahrens (Digital-Press-Stereolithographie) Restaurationen aus hochgefüllten Kompositen drucken. Klassisch befindet sich das flüssige Harz in einer Wanne, und in dieser Wanne befindet sich eine vertikal verfahrbare Bauplattform. Sie wird zunächst so weit an die Flüssigkeitsoberfläche gefahren, dass sich eine dünne Schicht Harz oben auf der Bauplattform sammelt. Diese dünne Schicht wird mit Licht an bestimmten Stellen, gemäß dem „Bauplan“, ausgehärtet. Die Bauplattform fährt dann ein Stückchen herunter, so dass sich oberhalb der ausgehärteten Schicht wieder eine dünne, zunächst noch flüssige Schicht Harz sammelt. Diese wird ausgehärtet, und die Bauplattform fährt wieder ein kleines Stückchen herunter und so fort.
Alternativ zur Wanne lässt sich das Harz in vakuumversiegelten Kapseln darreichen. Dies kann den Arbeitsablauf vereinfachen und beschleunigen, und es funktioniert in einer großen Spanne von Viskositäten, insbesondere mit hochviskosen keramikgefüllten Harzen.
Ein Riesenvorteil ist die Schnelligkeit. So wird die Versorgung mehrerer Zähne (oder mehrerer Patienten) nach Füllungsversagen zu einer „ganz normalen“ Therapieoption. Denn nun lassen sich parallel gleich mehrere Kronen, Inlays, Onlays und Veneers in wenigen Minuten fertigen und in die jeweiligen Praxen ausliefern.
Neben Metallen und Kunststoffen lassen sich sogar Keramiken additiv fertigen. So hat man aus Zirkonoxidkeramik bereits in einem Pilotprojekt ein subperiostales Kieferimplantat gedruckt und beim Patienten ohne Knochenaufbau in einem einzigen Eingriff eingesetzt.
Speziell für die Totalprothetik tritt ein neuartiger digitaler Workflow an. Es handelt sich um einen Zwei-Schritt-Fräsprozess. Er verbindet eine zahnfarbene PMMA-Disc mit einem klassischen Prothesenkunststoff, und kommt dabei ohne eine aufwendige Verklebung aus. Unter Rückgriff auf Zahnbibliotheken lässt sich eine effiziente ästhetische Gestaltung erreichen. Gegebenenfalls nach (kleinen) manuellen Anpassungen ist die Vollprothese fertig.
Kombination aus Komfort und reduziertem Erkrankungsrisiko
Schleifstäube, die bei solchen Anpassungen von Prothesen, Schienen etc. freiwerden, lassen sich mit einem neuartigen akkubetriebenen Saugsystem direkt am Ort der Entstehung effektiv entfernen. Das entsprechende Gerät kann dank seines geringen Gewichts einfach von einem Behandlungszimmer ins nächste mitgenommen werden und eignet sich darüber hinaus auch für mobile Einsätze.
Zur regelmäßigen professionellen Reinigung von Vollprothesen, generell von herausnehmbarem Zahnersatz sowie auch von kieferorthopädischen Apparaturen und Schienen bietet sich ein spezielles Gerät an. Zwanzig Minuten – Reinigung erledigt, und der Patient geht mit größerem Wohlbefinden und reduziertem Risiko für Mundgeruch und Lungenentzündung nach Hause.
In einer Sitzung versorgt – Kombi von allem in der Cloud
In der Praxis steigt die Zahl der Fertigungsoptionen: Kronen, Inlays und mehr lassen sich „chairside“ fertigen oder schnell einmal ins Praxislabor geben. So ist der Patient oft schon in einer einzigen Sitzung versorgt. Darauf legen immer mehr großen Wert, und es ist heute sogar für (dreigliedrige) Brücken aus Zirkonoxid machbar. Von Vorteil ist eine gut verzahnte digitale Vorgehensweise inklusive schneller Frässysteme und Speed-Sinteröfen. Alternativ dazu könnte in Zukunft die Zahnersatz-Fertigung im 3D-Druck erfolgen.
Die größte Innovationskraft in ganz unterschiedlichen Gebieten der Zahnheilkunde liegt jedoch in der Zusammenführung aller relevanten Informationen in sicheren Cloud-Systemen. Dateien hochladen anstatt sie per E-Mail oder Wetransfer zu verschicken, Software herunterladen und dabei sofort von den Fortschritten in der Künstlichen Intelligenz profitieren – diese Vorstellung ist heute keine vage Vision mehr, sondern (fast) greifbare Realität.
Wie verschiedene Cloud-Services ausgestaltet sind, liegt im Inneren der betreffenden Geräte und in ihrer Konnektivität begründet. Dies lässt sich im Einzelnen in Fachgesprächen an den Messeständen genau besprechen. Bei einigen Cloud-Diensten steht die vorausschauende Instandhaltung der Versorgungssysteme einer Praxis im Vordergrund (z.B. Kompressoren, Sauganlagen, Betriebswasser). Zum Beispiel wird der kompetente externe Techniker automatisch informiert, um Wartungen rechtzeitig vorzunehmen, und alarmiert, wenn es Anzeichen für ein reparaturbedürftiges Problem gibt.
Andere Services haben sich aus einer digitalen Praxisverwaltung heraus entwickelt. Sie machen nun geeignete Softwares zur Steigerung der Patientenzufriedenheit, für einen klimagerechten Betrieb oder für eine Verbesserung der ökonomischen Grundlagen der Praxis verfügbar. Wieder andere Cloud-Plattformen legen den Fokus auf eine sichere und komfortable Datenübertragung zwischen Laboren, Kliniken und Praxen. Ziel ist eine unmittelbare Verfügbarkeit aller benötigten Daten für einen nahtlosen digitalen Workflow, beispielsweise vom Intraoralscan bis zur gefrästen oder gedruckten Krone oder Brücke – das alles unabhängig vom Standort und von Softwarelizenzen.
Attachments im 3D-Druck – Biofeedback von der Schiene
In der Kieferorthopädie fließen viele Entwicklungen zusammen. So gibt es hier die ersten 3D-gedruckten Attachments. Zu ihren Vorteilen zählen eine hohe Präzision, Haltbarkeit und Farbbeständigkeit. Diese Attachments kommen unter anderem bei leichten Zahnfehlstellungskorrekturen im Vorfeld restaurativer Behandlungen zur Anwendung.
Für Kinder und Jugendliche sowie für Patienten mit schmalem Kiefer steht jetzt eine eigens entwickelte Schiene zur Linderung akuter CMD-Beschwerden zur Verfügung. Sie erfüllt gleich mehrere Funktionen, bietet sowohl eine neuromuskuläre Entlastung, löst adaptierte Schonhaltungen und gleicht okklusale Frühkontakte aus. Darüber hinaus lässt sie sich als Diagnostikum nutzen, um CMD-bedingte Beschwerden frühzeitig zu erkennen.
Für die Bruxismus-Therapie bringen spezielle Schienen jetzt einen integrierten Biofeedback-Mechanismus mit. Bei Knirscheraktivität im Schlaf vibrieren und summen sie (etwa wie man es vom Handy kennt), und zwar mit genau der richtigen Intensität, um den Bruxer nicht aufzuwecken und ihn dennoch sanft zur Einstellung des Knirschens zu führen. Dies schützt Zähne, Implantate und Kieferknochen vor Schäden und beugt schmerzhaften Folgesymptomen vor. Ein integriertes Auslesen der Daten ermöglicht eine präzise Analyse individueller Knirschmuster und eröffnet neue Möglichkeiten zur Stressprävention und zur Patientenaufklärung.
Eine Besonderheit, die Knirscher- bzw. Aufbissschienen und zum Beispiel auch Sportschutzschienen betrifft: Hier ist nicht die hohe Präzision einer klassischen Elastomerabformung gefragt. Daher lässt sich an dieser Stelle der Aufwand reduzieren, indem ein Quetschbiss genommen wird. Dank vorgeformter Wachsbisse mit „idealer“ Größe und Stärke und ohne Zwischenschicht bedarf es dabei jetzt nur noch einer geringen Erwärmung. So hat der Anwender eine bessere Kontrolle der Mitten bei der Bissnahme, und wegen des kürzeren und schmaleren Bisses ist häufig keine Beschneidung erforderlich.
Von puristischen Liegen bis zur hochkombinierten Einheit
Eine gesonderte Betrachtung verdienen die Geräte. Das beginnt bei Behandlungseinheiten führt über eine Vielzahl von Peripheriegeräten bis hin zu dentalen Versorgungseinrichtungen und laborseitigen Fertigungssystemen.
Bei den Behandlungsstühlen reichen die Philosophien von der puristischen Liege, an die alle Peripheriegeräte nach Bedarf herangefahren werden, bis hin zu stark integrierten Einheiten. Diese können ab Werk standardmäßig mit diagnostischen Funktionen ausgestattet sein (z.B. Transillumination, Fluoreszenzmodus und Intraoralkamera). Oder die installierten Mikromotoren erlauben über ein integriertes fluoreszenzgestütztes Identifizierungs-Verfahren die Erkennung von Verbundwerkstoffen (insb. von Kompositen) an behandelten Zähnen; das ermöglicht ein gezielteres Arbeiten und kürzere (Füllungs-)Therapie-Zeiten.
Wieder andere Behandlungsstühle sind optional mit endodontischen (z.B. Endo-Motor für kontinuierliche und/oder reziprokierende Feilenbewegung, endometrische Längenmessung, Feilenbibliothek) oder implantologischen (z.B. Implantatbibliothek) Elementen ausgestattet. Gegebenenfalls erlauben solche Systeme die Speicherung personalisierter Einstellungen für einzelne Behandler und eine komfortable Sprachsteuerung.
Anschauliche Bilder auf einem integrierten Monitor erleichtern die Aufklärung des Patienten, und gegebenenfalls macht ihm eine Massagefunktion die Sitzung angenehmer.
Nachhaltige Prophylaxe und Therapie, nachhaltiges Wirtschaften
Sowohl für die Umwelt als auch für die Identifikation des gesamten Teams und der Patienten mit einer Praxis werden ihre Anstrengungen für einen nachhaltigen, umwelt- und klimafreundlichen Betrieb immer wichtiger. Daher ist es eine gute Nachricht, dass sich in diesem Bereich immer wieder neue Spielräume auftun.
So etwa im Hygienebereich bei der Flächendesinfektion: Komplett plastikfreie Naturfaser-Tücher aus der zertifizierten Forstwirtschaft werden mit alkoholischen Lösungen ohne Aldehyde und Parfüme kombiniert. Oder bei der Desinfektion von Sauganlagen: Statt aggressiver Reiniger, die nur optisch saubermachen, setzen Hygieneteams auf spezielle Präparate für Praxis und Labor. Sogar ein neutraler pH-Wert (= 7) ist möglich – volle Wirkung, sanft zu den Geräten.
Auch der Energieverbrauch einer Sauganlage lässt sich beeinflussen. Moderne Ausführungen mit der sogenannten Radialtechnik (statt Seitenkanalverdichtung) arbeiten deutlich energieeffizienter. Das vermindert den CO2-Fußabdruck der Praxis und macht sich dazu noch positiv in der betriebswirtschaftlichen Rechnung bemerkbar.
Darüber hinaus kann Digitaltechnik die Nachhaltigkeit verbessern: Mit Hilfe einer digitalgestützten Praxisverwaltung etwa lassen sich Termine poolen (z.B. Kontrolluntersuchung bei Eltern und ihren Kindern). Über die Praxis-Website werden Patientinnen und Patienten auf attraktive Möglichkeiten zur Anfahrt mit Bus und Bahn hingewiesen. Beides reduziert die Zahl der An- und Abfahrten und damit den CO2-Fußabdruck des Praxisbetriebs.
Und bei Bestellungen gibt es heute oft die Option „klimaoptimierter Versand“: Nach Möglichkeit kommen viele Verbrauchsmaterialien in ein einziges Paket, statt sie „häppchenweise“ zu verschicken. Die Praxis kann dies durch eine vorausschauende Lagerhaltung und KI-gestützte Software – in der Praxis oder beim Händler bzw. Hersteller – kann dieses Konzept unterstützen. Alle Beteiligten sitzen hier in einem Boot und können jeden Tag neue Potenziale für ein nachhaltigeres Wirtschaften entdecken.
Für den IDS-Besucher ein Gewinn in der Kombination
Mit den auf der Internationalen Dental-Schau 2025 ausgestellten Konzepten, Verfahren und Produkten kamen Zahnärzte Zahntechniker und ihre Teams schnell auf den Stand der Technik. Je nach Region und Positionierung der einzelnen Praxis oder des einzelnen Labors fiel die Auswahl der geeigneten Geräte, Instrumente und weiteren Hilfsmittel unterschiedlich aus.
Auf Grundlage einer fundierten Basis an Informationen aus dem Besuch der 41. IDS 2025 sind Praxis und Labor in jedem Falle in der Lage gezielte Investitionsentscheidungen gemäß den hohen Zielen der World Health Organisation WHO, des Weltzahnärzteverbands FDI und der regionalen Zahnärzteverbände zu treffen und auf diesem Weg allen Menschen eine zeitgemäße Zahnmedizin zugänglich zu machen. Das ist heute für die ganze Welt ein realistischer Anspruch!
Die Dentalindustrie stellte dazu auf der IDS die gesamte Bandbreite der Therapiemöglichkeiten von der soliden Grundversorgung bis zur Highend-Dentistry „ins „Schaufenster“ – Bewährtes und Innovatives für die ganze Welt. Denn Zahnheilkunde ist in den Industrienationen der Nordhalbkugel anders aufgestellt als in Schwellenländern mit hochqualifizierter zahnmedizinischer Versorgung und ihrer Unterstützung durch die dortigen Regierungen, wie etwa in Vietnam, Ägypten oder Indonesien.
Wieder anders stellt sich die Situation in ausgesprochen armen Ländern dar. Positiv zu vermerken und auf der IDS zu spüren: Der politische Wille, dem Bedarf breiter Bevölkerungsschichten nach einer adäquaten zahnmedizinischen Versorgung nachzukommen, ist nahezu überall vorhanden.
Mit Hilfe der auf der IDS gewonnenen Informationen optimieren Praxen und Labors nun ihre Ausstattung und ihre Positionierung. Was sie an Konzepten, Verfahren und Produkten neu in ihre tägliche Arbeit integrieren, kommt letztlich den Patienten zugute.
Copyright: IDS Cologne
Bild: Koelnmesse GmbH; Kathrin Vogt

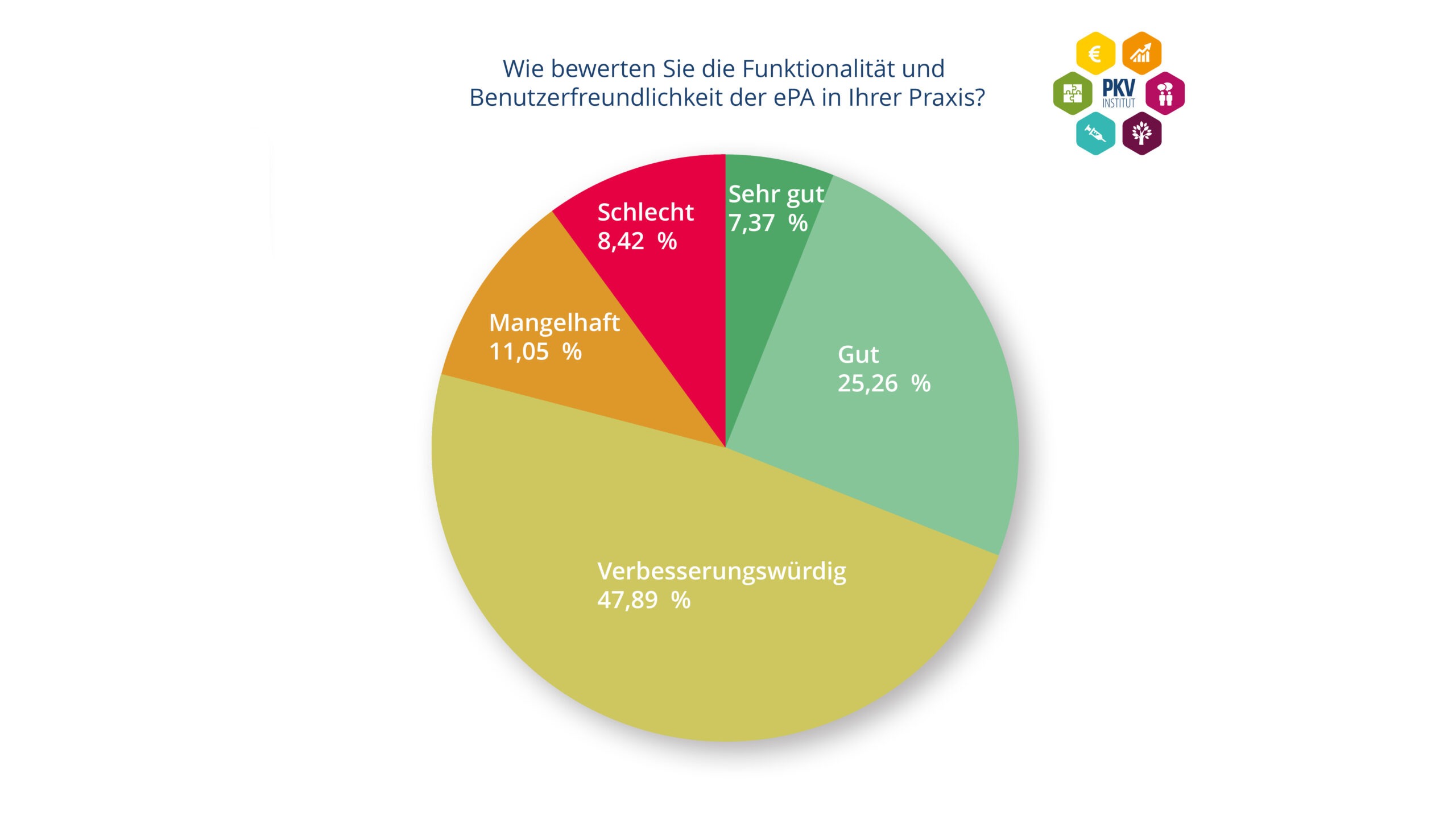
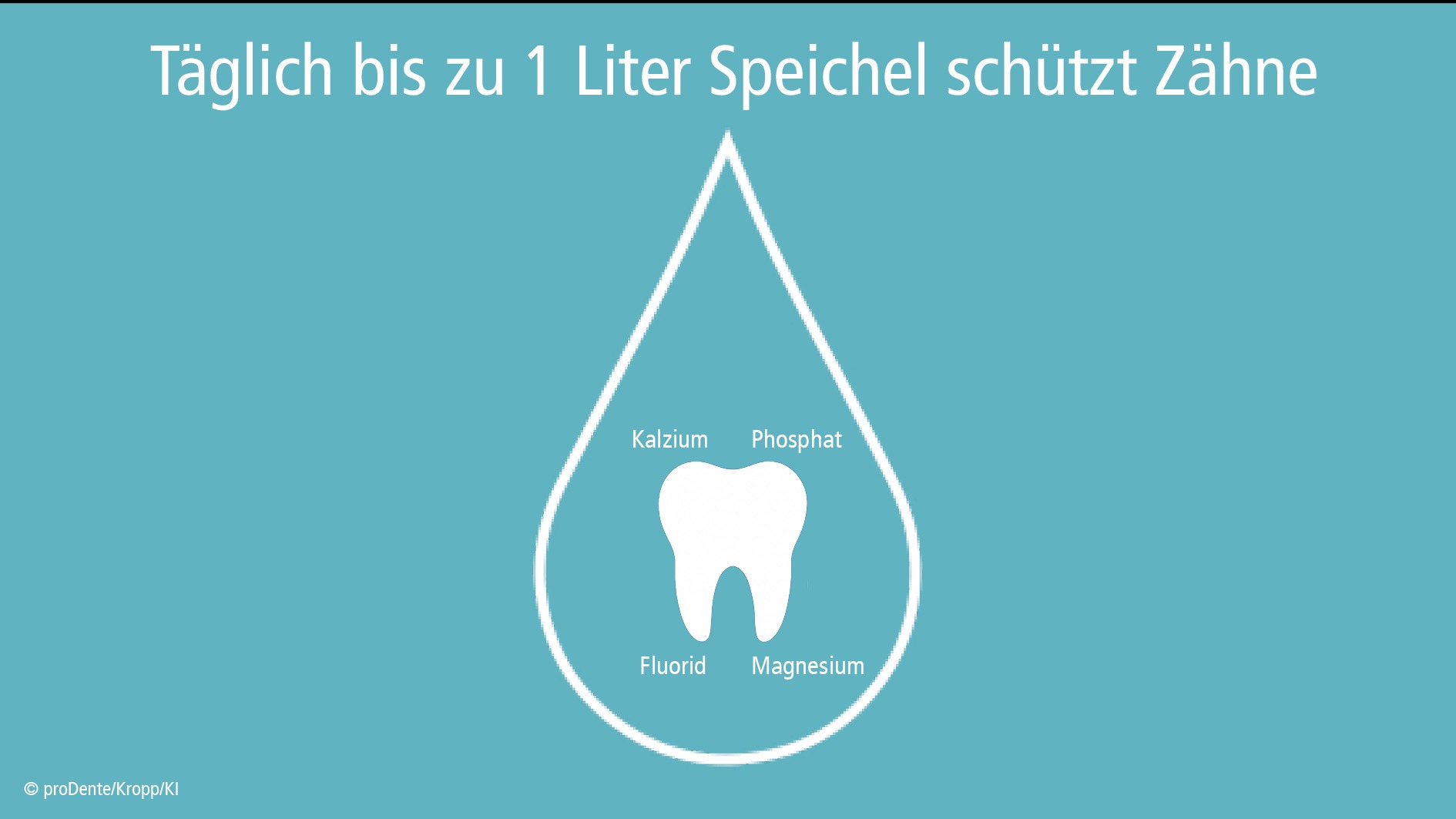





KEINE KOMMENTARE