Immer mehr ältere Menschen behalten ihre eigenen Zähne – doch besonders vulnerable Patientengruppen benötigen angepasste Therapiekonzepte und individuelle Beratung. Wie Praxisteams die Versorgung optimieren und Barrieren abbauen können, erläutert DH Heike Wilken.
Die zahnmedizinische Prävention der vergangenen Jahrzehnte war sehr erfolgreich – viele Patienten können heute ihre eigenen Zähne bis ins hohe Alter erhalten. Die Ergebnisse der 6. Mundgesundheitsstudie zeigen, dass nur noch 5 Prozent der 65- bis 74-Jährigen zahnlos sind. Gleichzeitig steigen jedoch die Erkrankungszahlen in dieser Altersgruppe: 51 Prozent weisen eine moderate und 34 Prozent eine schwere Parodontitis auf. Diese Entwicklung hängt maßgeblich damit zusammen, dass heute mehr eigene Zähne bis ins hohe Alter erhalten bleiben.
Zur besseren Einordnung werden ältere Menschen häufig in folgende Altersgruppen eingeteilt:
- Ältere Erwachsene: 65–74 Jahre
- Betagte: 75–84 Jahre
- Hochbetagte: ab 85 Jahren
- Langlebige oder sehr Hochbetagte: ab 90 Jahren
Diese Einteilung dient als grobe Orientierung, berücksichtigt jedoch nicht die große Heterogenität innerhalb der Gruppen. Entscheidend für die individuelle Versorgung sind vielmehr verschiedene Altersdimensionen:
- Das chronologische Alter beschreibt die reine Anzahl der Lebensjahre.
- Das biologische Alter umfasst die körperlichen und physiologischen Veränderungen im Verlauf des Alterns.
- Das psychologische Alter reflektiert das Verhalten, die Selbstwahrnehmung und die kognitive Leistungsfähigkeit.
- Hinzu kommen funktionale und soziale Faktoren wie Mobilität, Selbstständigkeit und Pflegebedürftigkeit.
So gibt es vital-aktive Hochbetagte ohne relevante Einschränkungen, während jüngere Personen aufgrund chronischer Erkrankungen bereits früh auf Unterstützung angewiesen sein können. Auch das subjektive Empfinden altersbedingter Veränderungen variiert stark: Was für den einen nur eine geringe Beeinträchtigung darstellt, kann für den anderen eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität bedeuten. Diese unterschiedlichen Alters- und Gesundheitsprofile haben direkte Auswirkungen auf die zahnmedizinische Versorgung, insbesondere im Umgang mit chronischen Erkrankungen wie Parodontitis, die nicht nur lokal, sondern auch systemisch relevant sind. Zu Beginn muss geklärt werden, wer gehört denn zu den vulnerablen Patientengruppen. Diese Gruppe umfasst Patienten, die einen Pflegegrad nach § 15 SGB XI haben oder Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX erhalten. Wenn bei diesen Patienten die Fähigkeit zur Mundhygiene entweder eingeschränkt oder nicht vorhanden ist oder die Patienten nicht kooperationsfähig sind, können sie der verkürzten Behandlungsstrecke zugeordnet werden. Aktuell gibt es 5,4 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Davon leben 70 Prozent zu Hause. Daher haben wir in jeder Praxis viele Patienten mit einem Pflegegrad. Da sind wir Prophylaxemitarbeitenden mehr denn je gefragt, denn es reicht nicht aus, auf dem Anamnesebogen nach dem Pflegegrad zu fragen. Oft wird diese Frage von Patienten als unwichtig angesehen und daher nicht beantwortet. Umso wichtiger ist es, gemeinsam mit unseren Patienten zu erörtern, warum der Pflegegrad für unsere Praxis von Bedeutung ist. Gerade für ältere Menschen stellt es häufig eine finanzielle Herausforderung dar, viermal im Jahr Unterstützende Parodontitistherapien oder präventive Sitzungen wahrzunehmen. Um unsere Patienten angemessen und bedarfsgerecht betreuen zu können, sind zunächst Aufklärung und eine individuelle Beratung unerlässlich.
Parodontitis-Therapie bei vulnerablen Patienten
Das Programm ParoStatus.de hat eine verkürzte Behandlungsstrecke implementiert, die den Workflow in der Praxis deutlich erleichtert. Doch wie lässt sich dieses Konzept konkret umsetzen, und welche Möglichkeiten stehen zahnärztlichen Teams zur Verfügung? Anders als in der klassischen PAR-Richtlinie muss die Behandlung bei dieser Patientengruppe nicht vorab bei der Krankenkasse beantragt werden. Stattdessen gibt es ein spezielles Formular, das vor Beginn der Behandlung lediglich ausgefüllt werden muss. In diesem Formular werden die geplanten Maßnahmen gegenüber der Krankenkasse dokumentiert. So erhalten diese Patienten einen gleichberechtigten und barrierearmen Zugang zur Parodontitis-Therapie. Wichtig: Es handelt sich hierbei nicht um eine Genehmigungspflicht, sondern lediglich um eine Anzeigepflicht. Das bedeutet, die Behandlung kann direkt in der gleichen Sitzung begonnen werden. Leistungen, die im Rahmen dieses Programms erbracht werden, müssen mit einem „S“ gekennzeichnet werden, da sie nicht budgetiert sind. Eine Ausnahme gilt für Patienten mit Pflegegrad, die jedoch motorisch nicht eingeschränkt sind und aus anderen Gründen einen Pflegegrad erhalten haben. Diese Patienten durchlaufen die reguläre Parodontitis-Therapie in der gewohnten Behandlungsstrecke. Allerdings muss in diesem Fall, die Therapie wie gewohnt beantragt werden.
Für die Behandlung ist entscheidend, dass auf dem Parodontitis-Plan die Leistungen entsprechend gekennzeichnet werden:
- Mit „P“ bei Patienten mit Pflegegrad
- Mit „E“ bei Patienten mit Eingliederungshilfe
Auch diese Leistungen sind nicht budgetiert, was den Praxisablauf erleichtert und gleichzeitig die Versorgung der Patienten optimiert.
Wie genau sollte der Parodontal Befund sein?
Erforderlich sind gemäß den Richtlinien zwar nur zwei Messstellen, doch reicht das aus? Um unsere Patienten bestmöglich begleiten zu können, empfiehlt es sich, wie gewohnt sechs Messpunkte zu dokumentieren. Patienten, die wir seit Jahren betreuen, sind mit unseren Abläufen vertraut, das stellt keine besondere Herausforderung dar. Auch nicht bei z. B. demenziell erkrankten Menschen, die die Abläufe gewohnt sind, da die Befundaufnahme, mit der im Programm ParoStatus implementierten PS Voice nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. So können Patienten weiterhin auf unserem gewohnt hohen Niveau langfristig betreut werden. Es ist nicht erforderlich, die Patienten zu klassifizieren, da alle Patienten dem Grad B zugeordnet werden. Nach AIT beziehungsweise CPT erfolgt der Übergang in die UPT-Strecke: entsprechend dem Grad B der regulären PAR-Strecke bedeutet dies zwei UPT-Sitzungen pro Kalenderjahr.
Wichtig zu wissen: Die geänderten UPT-Richtlinien, die ab dem 01.07.25 in Kraft getreten sind, beziehen sich nicht auf die Vulnerablen Gruppen. Für diese ergeben sich somit keine Änderungen. Das Fehlen von ATG, MHU, BEV sowie UPT a und b in der verkürzten Behandlungsstrecke im Vergleich zur regulären Strecke soll durch verschiedene präventionsorientierte Leistungen kompensiert werden: die Erhebung des Mundgesundheitsstatus, der individuelle Mundgesundheitsplan (174a) und die Mundgesundheitsaufklärung (174b). In Übereinstimmung mit der Richtlinie wurden hierbei die in § 22a SGB V ausdrücklich vorgesehenen Leistungen umgesetzt, wodurch neben der kurativen Therapie auch präventive Maßnahmen gestärkt werden. Dennoch stellt sich die Frage, ob die beschriebenen Leistungen nach § 174a/b, die jedem Patienten mit Pflegegrad oder Eingliederungshilfe auch ohne parodontale Erkrankung zur Verfügung stehen, ausreichen, um dem besonderen Betreuungsbedarf gerecht zu werden, der sich aus der Kombination von Mundhygienedefiziten und Pflegebedarf ergibt.
Fazit
Die bestmögliche Durchführung der parodontalen Therapie und der größtmögliche klinische Nutzen sind bei Menschen mit Pflegebedarf sicher nur zu erreichen, wenn sie unter Einbeziehung der Patienten selbst und aller an der Pflege Beteiligten erfolgen. Die Mundpflege erfordert im Vergleich zu früher mehr Kompetenzen. Zähne, Implantate und technisch aufwendiger Zahnersatz auf der einen Seite sowie Multimorbidität und Polymedikation auf der anderen Seite stellen große Herausforderungen im Praxisalltag da. Daher ist es wichtig, die verkürzte PA-Strecke in unser Behandlungskonzepte zu implementieren. Schulungsmaterialien stehen digital auf der Plattform mund-pflege.net zur Verfügung. Lohnenswert ist es in jedem Fall, den Newsletter zu abonnieren.
Interprofessioneller Workshop
Der nächste Workshop „Pflege und Zahnmedizin im Dialog“ findet vom 14. bis 15. November 2025 in Ulm als Präsenzveranstaltung statt. Zur Vorbereitung startet vom 27. bis 29. Oktober 2025 eine begleitende Online-Kursreihe. Das Besondere: Pflegekräfte- und Prophylaxe-Fachkräfte nehmen gemeinsam an diesem interprofessionellen Kurs teil – so wird der Austausch und das Verständnis für die jeweilige Arbeitsweise gefördert.
Die DGDH möchte sich im Zuge des neuen Expertenstandards zur Förderung der Mundgesundheit in der Pflege als starker Partner einbringen. Ziel ist es, die Mundgesundheit von Menschen mit Unterstützungsbedarf sowohl in Praxen als auch in Schulungen für Pflegekräfte nachhaltig zu verbessern.
Der Workshop wird von Prof. Dr. Annett Horn und Dr. Elmar Ludwig geleitet und kombiniert Online- und Präsenzanteile für eine praxisnahe Weiterbildung. Weitere Informationen und Anmeldung unter https://dgdh.de/fortbildungen/

DH Heike Wilken
Titelbild: © Adobe Stock/Gerhard Seybert

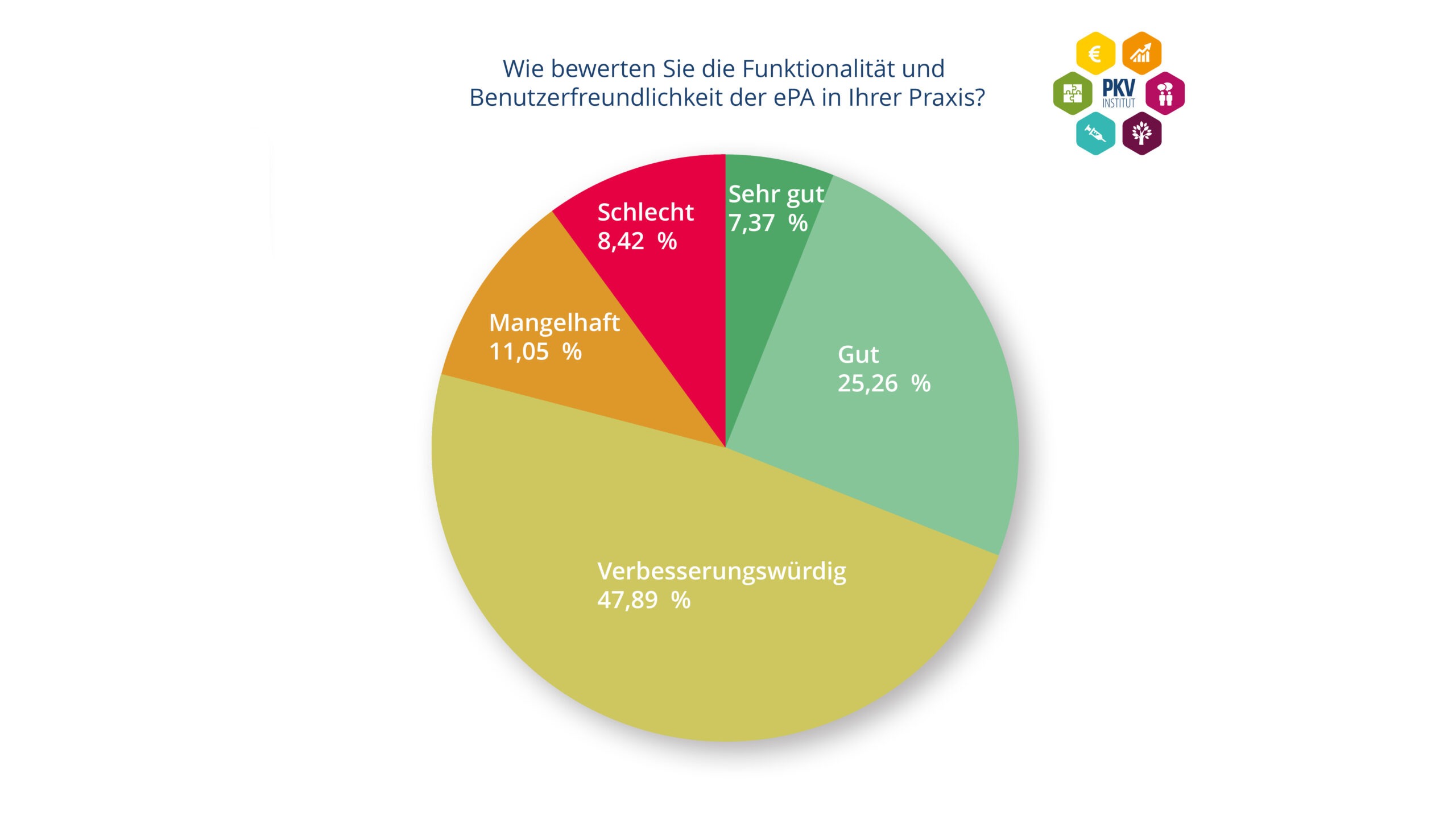
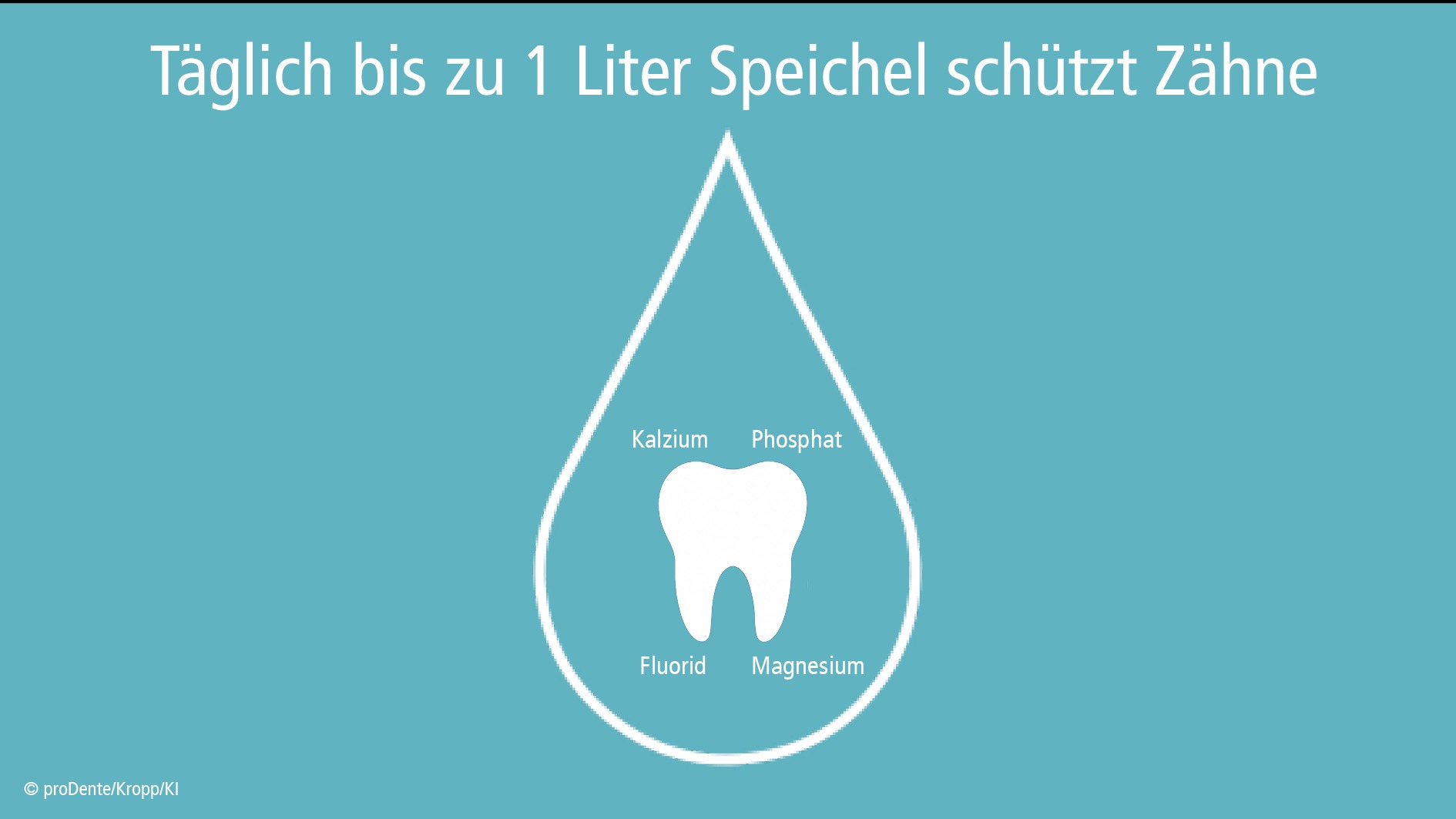





KEINE KOMMENTARE